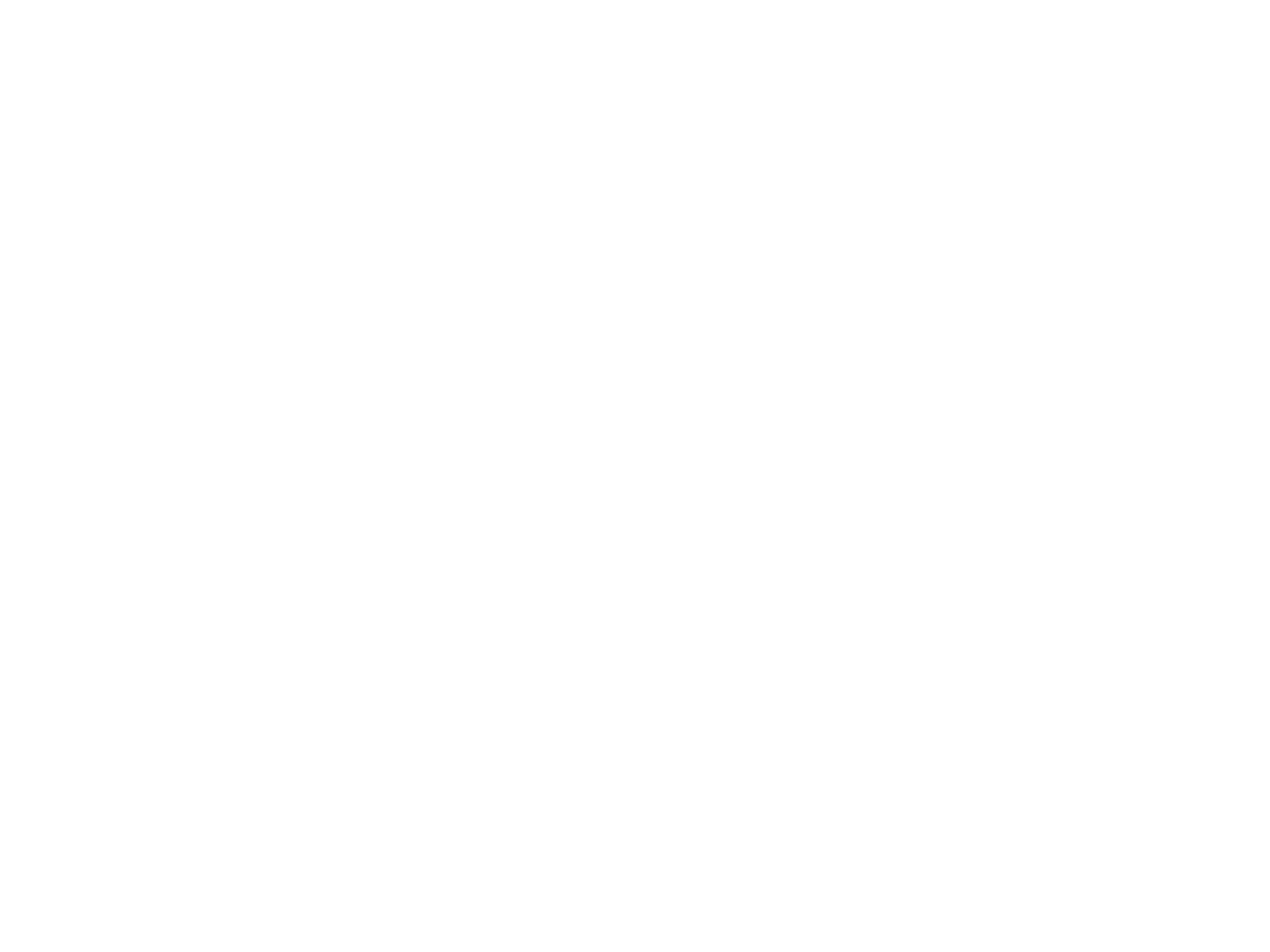Die Zeitschrift Testcard #19 mit dem Schwerpunkt „Blühende Nischen“ erschien zwar schon im März, bei unkultur mahlen die Mühlen aber langsamer und ich bekam die Ausgabe erst vor kurzem in die Hand.
Sehr interessant fand ich die Ausführungen im Artikel von Martin Büsser in „Das Ende der Pop-Relevanz und das Wuchern der Nischen“. Allerdings fragte ich mich, ob diese nicht eine Fortschreibung des „Mainstream der Minderheiten“-These der 1990er Jahre darstellen. Martin Büsser beschreibt den Wandel als Verlust eines musikalischen Kanons innerhalb der Rezeption von Musik sowie des Schwindens von Publikum als Masse: „Neue, auf Pop gegründet Jugendbewegungen, wollten sich einfach nicht mehr bilden.“ Nur wird man hier keine Antworten erhalten, wenn man nur darauf schaut, was fehlt und den Wandel versucht in den Kategorien von Jugendsubkulturen zu erfassen. Was ist denn dort, wo früher Bewegung gewesen wäre? Andererseits: interessiert mich das wirklich? (Der Beitrag von Jasper Nicolaisen über Bildproduktion im Internet geht in diese Richtung. Am Ende landet man bei allerhand obskuren und interessanten Phänomenen, mit Musik hat das alles nichts mehr zu tun.)
Martin Büsser beschreibt einen Zustand, den er durch Orientierungslosigkeit auf Seiten des Publikums charakterisiert sieht. Ich fragte mich an der Stelle, ob es nicht eher eine Unübersichtlichkeit handelt. Damit meine ich, dass das was Martin Büsser beschreibt, ein Problem für eine Kategoriesierung darstellt. Und diese stellt weniger das Publikum vor ein Problem, als die KritikerInnen, die versuchen Erklärungen und Begriffe für die beobachteten Phänomene zu finden. Und gerade die Soziologie ist eine Wissenschaft der Massenphänomene. Beschäftigt ein Phänomen nur mich und meine drei FreundInnen, lässt sich hier kaum ein soziologischer Forschungsaufwand rechtfertigen.
Dieses Schwinden von Masse wird ja auch an ganz anderer Stelle – der Forschung zu Instutionen wie Parteien etc. – beklagt. Nur besteht das Problem m.E. für die Forschung, die von Masse auf Relevanz ihres Gegenstandes schließt und damit daran unmittelbar die eigene Relevanz bindet. Das Publikum als Masse schwindet und das sieht Martin Büsser begründet im „Resultat einer immer kleinteiligeren Ausdifferenzierung, die mit Jugendkultur im herkömmlichen Sinne nichts zu tun hat.“ Nur stellt das an der Stelle ein Problem für die Forschenden dar, deren Begriffsinstrumentarium nicht mehr greift, um diese Welt zu beschreiben. Kurz gefasst: man wird das Scheitern der bisherigen Begriffe in Betracht ziehen müssen: Szene, Jugend(-subkultur), Avantgarde, Mainstream und Underground.
Wer ebenso ein Problem mit dem Schwinden der Masse hat, sind MusikjournalistInnen, deren Arbeit gleich doppelt prekär besetzt ist: Journalismus und dazu noch im Bereich Musikwirtschaft, die in einer Krise und grundlegenden Transformation steckt. Thesenhaft würde ich hier vermuten, dass der Bedarf für kritisches Schreiben über Popmusik schwindet. Die Zirkulationsgeschwindigkeit der Musikwaren hat sich m.E. deutlich erhöht. Martin Büsser bemängelt hier eine fehlende Relevanz, etwa von beliebiger Auswahl von Charts im Rolling Stones Magazine.
Aus der Perspektive elektronischer Musik wirkt diese Frage leicht befremdlich, denn hier ist klar, dass die Releases eh niemals mit dem Anspruch angetreten sind, für immer da zu sein, sondern an einem spezifischen Moment der Geschichte eine vergänglichem, kurzlebige Relevanz zu entfalten.
Ich bin mir an der Stelle nicht sicher, ob die Masse verschwunden ist. Sind wirklich alle zu Außenseitern geworden? Da könnte es sein, dass Martin Büsser in der Perspektive der Nischenmusik verharrt – die auch vor 20 Jahren Nische gewesen wäre. Insofern die Frage nur auf die Nische und konstatiere: „Da ist nur Nische.“ Lady Gaga verkauft tatsächlich noch Tonträger und auch Festivals wie „Rock am Ring“ sind nach wie vor von Menschenmassen bevölkert. Wo geht also der Konsens verloren?
Vielleicht so formuliert: Die Position der Institutionen schwindet, die die Relevanz von Musik verschriftlicht. Nur ist das zunächst ein Problem für diese Instutionen, und zunächst nicht für die unmittelbare Produktion von Musik selbst. Denn dieses scheint ja auch ganz gut ohne die Figur des Musikkritikers/ der Musikkritikerin auszukommen. Es herrscht ein reges Treiben und eine ungeheure Menge an Musikwaren, aber das Interesse an einer theoretischen Klassifizierung scheint zu schwinden (an der Stelle: der/die DJ ordnet Musik nach persönlichen Kriterien auch an und nimmt in nicht-textlicher Form eine Kanonisierung vor).
Nur heisst das für das Schreiben über Musik: wo die Relevanz nicht mehr gegeben ist, sind weder Forschungsetats anzuzapfen, noch lassen sich Gelder von Werbeträgern oder Sponsoren auftreiben, die Herstellung der Texte und deren Publikationen finanzieren.
Damit teilt die Popkritik das Schicksal mit der Musik selbst. Es würde sich lohnen, hier weiter nachzuhaken: schwindet damit die Möglichkeit von Kritik? Denn schließlich ermöglicht erst das Heraustreten aus dem unmittelbaren Erleben. Die Transformation des Hörerlebnisses in Sprache ermöglicht eine kritische Reflexion des Gegenstandes. Eine gegenteilige Auffassung von Musikjournalismus ist selbiger als verlängerte Gute-Laune-Botschaft und Werbetext, worüber ich mir vor einigen Monaten am Beispiel der BBC Radio1 Moderatorin Mary Anne Hobbs Gedanken machte. Ob man hier kulturpessimistisch den Verlust kritischer Öffentlichkeit beklagen muss, oder Kritik sich künftig andersweitig artikulieren wird, bleibt offen. Vielleicht gab es eine zeitlang in Deutschland ein Zweckbündnis aus Musikkritik und Schallplattenindustrie, das irgendwann obsolet wurde. Ich frage mich, ob es diesen „Diskurs jenseits der sich selbst überlassenen Kleinstnischen“ jemals gab. Jedenfalls jenseits von Diedrich Diederichsen und der Spex der späten 1980er Jahre. Vielleicht entfällt auch das Interesse auf Seite des Publikums an einem Lesen über Musik. Wo sowieso schon so viel Musik vorhanden ist, dass sich der „noch zu hören“ Berg niemals abträgen lässt, lässt auch das Interesse am darüber Lesen nach. Wozu auch? Es ist doch sowieso zu viel von allem da.
Das Problem ist ein ökonomisches – und zwar für die ProduzentInnen von Waren. Mit dem Schwinden einer massenhaften Rezeption von Musik schwindet die Möglichkeit für diese, von ihren Produkten zu leben – sei es im unmittelbar mit der Produktion von Musik, sei es mittelbar mit dem Schreiben darüber. Als hätte sich D.I.Y. als Dystopie verwirklicht: Die kaptialistische Konkurrenz sowie der Zwang seinen Lebensunterhalt monetär zu bestreiten sind nicht außer Kraft gesetzt, dafür darf jede und jeder die Welt mit Waren überfluten, für die sich keine KäuferInnen mehr finden lassen.
Um zum Ende zu kommen und spekulativ in den Raum zu denken: an den Geräten lässt sich eine Veränderung der Entwicklung ablesen. Wahrscheinlich das Handy, dass als Multifunktionsgerät nahezu alles kann. Es lässt sich nutzen um damit zu telefonieren, Emails schreiben, von der Wasserwaagen- bis zur Navigationsapp ist alles darauf, es ist Spielkonsole, man kann damit Musik hören (+ Musik produzieren) oder Videofilme und Photos aufnehmen und ansehen. U.a. auf die Bildproduktion hat das ebenso gravierende Auswirkung wie auf die Wahrnehmung von Musik. Musik ist als digitales Format vorhanden und damit ebenso verfügbar wie andere digitale Daten. Musik konkurriert um Aufmerksamkeit mit Computerspielen, Videos etc. Die Wahrnehmung von Musik verändert sich, es kommt zur Synästhesie. Musikmagazine online funktionieren 2010 anders als gedruckte Hefte 1990. Die Vermischung aus Journalismus und Musikpromotion schreitet voran, wenn neben dem Artikel gleich ein Widget mit einem Soundfile zu finden ist (zufällig gewähltes Beispiel siehe http://www.urb.com/). Der Druck auf die ProduzentInnen steigt Freebies und Promomaterial in großen Mengen zu produzieren. Gleichzeitig ist Information überall verfügbar und es besteht die Möglichkeit – etwa via Blogkommentare – Texte von Seiten des Publikums aus direkt zu kommentieren.
Nur führt dies nicht zum Schlaraffenland der freien Güter, sondern der Datenstress des Bescheidwissen-Müssens. Wie Geert Lovink es formulierte: Freizeit ist Downloadzeit. Man wird sich Begriffe suchen müssen, um diesen Wandel zu fassen.